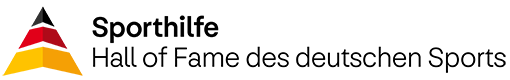
Cornelia Hanisch
Fechten

- Name Cornelia Hanisch
- Sportart Fechten
- Geboren am 12. Juni 1952 in Frankfurt/Main
- Aufnahme Hall of Fame 2016
- Rubrik 80er Jahre
Cornelia Hanisch
Fechten
Gößte Erfolge
- Olympia-Gold Mannschaft 1984
- Olympia-Silber Einzel 1984
- Weltmeisterin Einzel 1979, 1981, 1985
- Weltmeisterin Mannschaft 1985
- WM-Silber Mannschaft 1977, 1978, 1981
- WM-Bronze Einzel 1978
- WM-Bronze Mannschaft 1982
- Europameisterin 1983
- EM-Bronze 1981
- Gesamtweltcupsieg 1982
Auszeichnungen
- Sportlerin des Jahres 1985
- Silbernes Lorbeerblatt 1980

1979 gewinnt Cornelia Hanisch ihren ersten großen internationalen Titel: In Melbourne holt sie als erste Deutsche seit 1961 WM-Gold.

Aufgrund des Boykotts 1980 kommt Hanisch erst 1984 zu olympischen Meriten. Im Einzel muss sie sich zunächst mit Silber zufrieden geben.

Kurz darauf wird sie mit der Mannschaft Olympiasiegerin - mit einer Gold- und einer Silbermedaille ist sie die erfolgreichste Deutsche der Spiele von Los Angeles.
Biografie
Für Cornelia Hanisch war es immer eine „ungeheure körperliche Befriedigung“, wenn sie abends „fein müde“ aus der Sporthalle kam. Wenn ihr Training beendet war und sie „wie ein Bauer auf dem Feld“ ihr Tagewerk vollbracht hatte. „Schwitzen, kämpfen, kaputt sein“, das alles gehörte für die erfolgreiche Fechterin zu einem erfüllten Leben dazu. Trainieren, schlafen, essen – der Dreiklang der Leistungssportler vor einem großen Ereignis bedeutete für sie nicht Einschränkung oder gar Langeweile, sondern Glück, sich fokussieren zu können, ihre Energie zielgerichtet einsetzen zu können. „Ich will die Beste sein“, hieß ihr Mantra, war ihre Motivation, seitdem sie „am Erfolg gerochen“ hatte. Und sie wurde die Beste: Einzel-Weltmeisterin 1979, 1981 und 1985 im Florett-Fechten, dazu Olympiasiegerin mit der Mannschaft 1984.
„Ich hatte immer großen Spaß daran, alles sehr gut zu machen“, sagt die zierliche Frau mit der energischen Ausstrahlung über ihren Ansporn, den sie sich zum Lebensprinzip erhoben hat. Im Leistungssport wie im Leben danach als Lehrerin. „Alles gut machen“ lautet ihr Anspruch, vor allem an sich selbst, aber auch an ihre Schüler. Dass aus dem perfektionistischen Ansatz aber keine Verbissenheit wurde, dafür sorgte ihr Naturell: „Ich bin zu optimistisch, um verbissen zu werden“. Leistungswillen und Lockerheit schließen sich ihrer Meinung nach nicht aus. „Wenn es heute nicht geklappt hat, dann mache ich es morgen.“ Diese Einstellung sei ihr nach Fehlschlägen immer Trost gewesen.
Sie wurde am 12. Juni 1952 in Frankfurt am Main geboren, gilt aber als Offenbacherin. Cornelia Hanisch trainierte im Fechtclub Offenbach (FCO) und feierte für den FCO ihre Erfolge. Seit 30 Jahren arbeitet sie als Berufsschullehrerin an der Käthe-Kollwitz-Schule (KKS), ebenfalls in Offenbach. „Meine erste Schule wird auch meine letzte sein“, sagt die 63-Jährige, die Deutsch, Mathe und Politik unterrichtet, dazu Computerlehre. „Sportlehrerin stand nicht zur Debatte“, sagt Hanisch, obwohl sie neben ihrer Fechtkarriere auch Sport studiert hatte. Doch bei ihrem Einstieg ins Berufsleben fehlte an der KKS noch eine Sporthalle. Außerdem war die Fechtmeisterin auch gar nicht so scharf drauf, Sport zu unterrichten: „Wenn man zwei Mal am Tag Leistungssport gemacht hat…“, sagt sie und lässt den Satz unvollendet.
Stattdessen macht sie ihre Schüler fit fürs Berufsleben. Die jungen Leute, deren Wurzeln in aller Herren Länder liegen, aber in Offenbach gelandet sind, absolvieren dort ein Berufsvorbereitungsjahr. Sie versuchen, den Hauptschulabschluss nachzuholen. Viele gelten als „schwierig“, wobei es meistens eher die Verhältnisse sind, aus denen sie stammen. Cornelia Hanisch lässt sich von solchen Kategorisierungen sowieso nicht abschrecken. „Nichts kann frustrierend sein, was mit Menschen zu tun hat“, sagt sie. Ihren Beruf bezeichnet sie als „genial“. Sie liebt die Herausforderung, will sich auch selbst „ständig verbessern“ bei der Art, wie sie ihren Stoff darbietet. In den meisten Fällen schafft sie es, die jungen Leute auf den richtigen Weg zu führen – und freut sich, wenn sie dem ein oder anderen in neuen Lebenssituationen wieder begegnet.
Eigene Kinder hat sie nicht. Es war ein Verzicht, als Verlust sehe sie es nicht, erklärte sie einmal in der FAZ. Als Lehrerin hat sie ständig mit Jugendlichen zu tun. „Was brauchen Sie Kinder, Sie haben doch uns“, bekomme sie immer mal wieder von den Schülern zu hören, sagte sie in dem Interview. Ihre Lebensgeschichte als Sportlegende spielt im Schulalltag praktisch keine Rolle. Die wenigsten Schüler wissen von ihren früheren Heldentaten, und wenn sie doch einmal darauf angesprochen wird, lenkt sie vom Thema ab. Cornelia Hanisch ist stolz auf ihre Erfolge, doch damit hausieren gehen oder sich gar darauf ausruhen – das entspricht nicht ihrer Art.
Für ihren Lorbeer hat sie hart gearbeitet, in den späten 70er und frühen 80er Jahren. Etwa 2000 Trainerstunden musste sie investieren, bis sie zum ersten Mal Weltmeisterin wurde, rechnete sie aus. „Ohne die Sporthilfe hätte ich meinen Sport so nicht machen können“, sagt sie. Nur dank der Unterstützung konnte sie in den entscheidenden Phasen „eingleisig“ fahren – nur das machen, was sie wollte. Ohne Rücksicht auf Nebenbeschäftigungen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Konzentration auf das Wesentliche. Dafür ist sie der Sporthilfe bis heute dankbar, ebenso wie ihrem Trainer Horst Christian Tell, der sie an die Weltspitze führte.
Tell hatte im Gegensatz zu anderen Trainern der damaligen Zeit die Umstellung aufs moderne Fechten geschafft. Anfang der 70er Jahre war er nach Offenbach gekommen. Für Cornelia Hanisch, die damals schon 20 war, wurde Tell zum entscheidenden Mann: er formte die „Spätstarterin“ zu einer Spitzenathletin. Eine seiner Spezialitäten war das Erstellen von Gegnerprofilen. Tell konnte die Konkurrentinnen auslesen, wusste um ihre Stärken und Schwächen, und wie man sie treffen konnte.
Im Training übernahm der Trainer als Sparringspartner die Rolle der Gegnerinnen, imitierte deren bevorzugte Aktionen und ließ die Gegenmittel so lange einüben, bis Cornelia Hanisch im echten Gefecht einen Vorteil daraus ziehen konnte. „Dieses psychische Training“, sagt Hanisch heute, habe damals sehr viel Kraft und Energie gekostet. Doch sich so fokussieren und konzentrieren zu können, sei auch ein Schlüssel zum Erfolg gewesen. Fechten ist ein Kampfsport ohne wirklichen Körperkontakt, er wird zu einem wichtigen Teil mit dem Kopf entschieden. Wer sich von den „Spielchen“ seiner Gegnerin ablenken lässt, hat schon so gut wie verloren. Wer aber deren Stärken durch Antizipation entkräften kann, vergrößert zugleich die eigenen Gewinnchancen. Und Cornelia Hanisch war eine Meisterin darin.
Der größte Sieg blieb ihr trotzdem nicht vergönnt, die durchaus mögliche Olympische Goldmedaille von 1980 wurde auf dem Altar der Sportpolitik geopfert. Der Olympiaboykott der Spiele von Moskau durch die Amerikaner und ihrer westlichen Verbündeten wegen des russischen Einmarschs in Afghanistan schnitt brutal in ihre erfolgreichste Phase ein: 1979 war sie Weltmeisterin, 1981 wurde sie es wieder. Aber 1980 durfte sie nicht Olympiasiegerin werden. Erst das Mannschaftsgold vier Jahre später entschädigte halbwegs für den Verlust.
Unabhängig von den eigenen sportlichen Chancen hatte die stets streitbare und politisch denkende Athletin, die sich auch in der Friedenbewegung engagierte, den Boykott nicht als das angemessene Mittel gesehen, um den Afghanistan-Konflikt lösen zu können. Wenn man etwas ändern wolle, müsse man miteinander reden, meinte sie damals wie heute. „Sport ist Begegnung“, sagt sie. Und wer die Chance habe, sich zu treffen, der solle diese Möglichkeit auch nutzen. Meinungsverschiedenheiten und Konflikte, so ihre Erkenntnis, die sie auch im Schulalltag bestätigt sieht, lassen sich nur durch Gespräche lösen. Neben der grundsätzlichen Frage, ob der Sport ein Vehikel der Politik sein dürfe, stieß ihr bei der Moskau-Frage besonders bitter auf, dass die Entscheidung von oben herab gefallen war. Keiner der Sportler sei tatsächlich gefragt worden. Und diese Rolle als Bauernopfer missfiel ihr gewaltig.
Auch die aktuelle Misere im deutschen Fechtsport beobachtet Cornelia Hanisch mit einer gewissen Sorge, dabei ist sie allerdings weit davon entfernt, ihre „Nachfolger“ für das vermeintliche Versagen zu kritisieren. Vielmehr stellt sie die Systemfrage, und die gleich auf mehreren Ebenen: International sieht sie sowohl Wettkampfmodus als auch Qualifikationssystem als fragwürdig an. National würde sie stärkere Trainingsgruppen einrichten. „Fechter brauchen Gegner“, sagt sie und erinnert daran, dass auch sie ohne ihre Trainingspartnerinnen nicht so großen Erfolg gehabt hätte. Das Beispiel der Dormagener Säbelfechter, die alle am gleichen Standort trainieren und gemeinsam in die Weltspitze vorstießen, sieht sie als stilbildend für die Zukunft des deutschen Fechtsports an. Dagegen hemme die Kleinstaaterei an vielen Standorten die Möglichkeit der Einzelkämpfer in ihrer fechterischen Entfaltung.
Beim Internationalen Fechtverband (FIE) bekommt sie dagegen den Eindruck, dass ihm beim Anspruch, sich als Weltsportart auszubreiten, das Maß verloren ging. Dass deutsche Sportlerinnen, die zu den besten 20 der Welt gehören, sich nicht für Olympia qualifizieren, weil ein weltweites Teilnehmerfeld mit zum Teil nicht konkurrenzfähigen Fechtern aufgeboten werden soll, bezeichnet sie als unfair. Dass Mannschaftswertungen die Qualifikation zu den Einzel-Wettbewerben dominieren, erscheint ihr unlogisch.
Auch haben sich die Anforderungen geändert: Im Gegensatz zu ihrer Zeit, als die Turniere in Paris oder Como stattfanden und eine Wettkampftour nur ein verlängertes Wochenende in Anspruch nahm, werden die Athleten heute rund um den Globus gejagt, um auf allen Kontinenten zu fechten – dort aber zumeist vor leeren Rängen. Gleichzeitig haben die Wettkämpfe ihren Charakter geändert – während früher zwei bis drei Runden mit 20 bis 30 Gefechten anstanden, wodurch auch Kondition zu einem limitierenden Faktor wurde, stehen heute K.o.-Duelle an. Wodurch Weltreisen zu Wettkampfzwecken noch absurder erscheinen, wenn das Aus nach dem ersten Gefecht droht.
Cornelia Hanisch selbst hat mit dem Fechten nach dem Ende ihrer Spitzen-Karriere komplett aufgehört. Als Hobbykämpferin steht sie nicht zur Verfügung, das verbietet ihr Ehrgeiz. „Wenn man mal so gut war, dann ärgert man sich ja nur noch“, meint sie. Stattdessen hat sie Tennis gelernt und sich dabei ausgepowert, ebenfalls in einer Duell-Sportart, bei der die Psyche eine entscheidende Rolle spielt. Immerhin „von null bis Regionalliga“ führte sie ihr zweiter Sportbildungsweg. Wegen Kniebeschwerden musste sie leider aufhören, heute spielt sie nur noch Golf. Dabei freut sie sich vor allem an der Bewegung und hat festgestellt, dass ihre Lust auf Wettkampf nicht mehr ganz so ausgeprägt ist wie früher. Freilich hat sie immer noch Spaß daran, ihren Ehemann im Lochspiel zu schlagen.
Achim Dreis, Juli 2016




