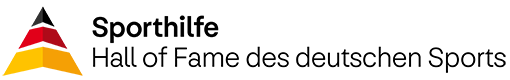
Michael Schumacher
Motorsport

- Name Michael Schumacher
- Sportart Motorsport
- Geboren am 3. Januar 1969 in Hürth-Hermülheim
- Aufnahme Hall of Fame 2017
- Rubrik 90er Jahre bis heute
Michael Schumacher
Motorsport
Größte Erfolge
- Siebenmal Formel-1-Weltmeister: 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004
- 91 Grand-Prix-Siege
- 155 Podiumsplätze
- 68 Pole Positions
- 77 schnellste Rennrunden
- 5114 Führungsrunden
Auszeichnungen
- Bambi Millenniumpreis (2014)
- Legende des Sports beim Deutschen Sportpresseball (2012)
- Deutscher Fernsehpreis (2007)
- Zweimal Sportler des Jahres (2004 und 1995)
- Sportler des Jahrhunderts (ZDF, 2004)
- Weltsportler des Jahres (Laureus, 2004 und 2002)
- ADAC Motorsportler des Jahres (2000 und 1992)
- Silbernes Lorbeerblatt (1997)
- Goldener Löwe (RTL, 1997)
- Goldene Kamera (Hörzu, 1995)
- AvD-Sportpreis (1994)
- Goldene 1 (ARD, 1994)
- Bambi (1993)
- Goldendes Lenkrad (Bild am Sonntag, 1993)

Im nächsten Schritt kommt er zur Formel 3. Hier feiert er bereits erste Erfolge, bevor er schließlich in die Formel 1 wechselt.

Fast exakt ein Jahr nach seinem ersten Rennen gewinnt Schumacher an selber Stelle seinen ersten Formel 1 GP.

Mit dem Team Benetton setzt er seine Erfolgsgeschichte fort. 1994 wird er zum ersten deutschen Formel 1 Weltmeister. Ein Titel, den er 1995 verteidigen wird.

Diese Durststrecke beendet Schumacher im Jahr 2000 und holt für Ferrari den lang ersehnten WM-Titel.

Es folgen Jahre der Dominanz, in denen "Schumi" zum neuen Gesicht Ferraris wird und in Deutschland einen regelrechten Hype um die Formel 1 entfacht.

In den Jahren 2000 bis 2004 gewinnt Schumacher fünf mal die Fahrer-WM. Insgesamt ist er damit siebenfacher Weltmeister - bis heute Rekord.

Für diese Leistungen wird Schumacher u.a. zwei Mal zum Laureus Weltsportler des Jahres gewählt (2002 und 2004).

Nach seinem vorläufigen Abschied aus der Formel 1 (2006) gibt Schumacher 2010 für Mercedes sein Comeback.
Biografie
Michael Schumacher war ein vorsichtiger Mensch auf der Rennstrecke. Das passt nicht zu einem Piloten, der die Formel 1 beherrschte, wie keiner vor ihm? Seine Vorsicht war die Voraussetzung für diese unglaubliche Karriere: Ein Junge aus Kerpen, mit kaum Geld in der Tasche, schwingt sich auf zum Chefpilot der teuersten Sportart der Welt: 91 Grand Prix-Siege, sieben WM-Titel, Rekorde, wie sie keiner vor ihm aufstellte. Mit Hochmut, mit Arroganz, mit purer Aggressivität wäre er schnell gescheitert. Wahrscheinlich zerschellt an einer Leitplanke.
Bei einem Treffen zweieinhalb Monate vor seinem fatalen Skiunfall Ende Dezember 2013 sprach Schumacher engagiert über die Bedeutung von Talent. Ist nicht vor allem die harte Arbeit letztlich die Quelle des Erfolges? Schumacher tippte sich an die Schläfe und sagte sinngemäß: „Du musst ein Grundtalent haben, aber die Entwicklung steuert dann der Kopf. Was will ich, was kann ich, wie werde ich mich steigern?“
Er wusste nicht mehr, wann dieser Prozess bei ihm begonnen hatte. Als Vierjähriger hatte ihm sein Vater, einst Pächter der Kartbahn von Kerpen, in so ein Gefährt gesetzt. Von diesem Moment an ließ ihn die Faszination nicht mehr los. Da mochte der Fußball im Verein locken, da mochten Freunde rufen, Lehrer mahnen, die Sehnsucht nach einem Urlaub am Meer wachsen: Dieser typische Alltag eines Jungen in Deutschland der Siebzigerjahre wurde überstrahlt von einer Leidenschaft, wie man sie nur von berühmten Künstlern, etwa aus Musikerbiographien kennt: Nichts als das Klavier für den kommenden Weltstar unter den Konzertpianisten, nichts als das Kart für den ersten deutschen Formel-1-Champion.
Seine Schule war die Kartbahn. Wenn er beim Mittagessen saß, so erzählte er vor vielen Jahren, dann hörte er am Sound der Motoren, wer da seine Runden drehte. Diese intensive Auseinandersetzung hat ihn Runde um Runde wachsen lassen, seine Fähigkeit geschult, präziser als andere unterscheiden zu können. Die finanzielle Not mag dabei eine Rolle gespielt haben. Geld für Reifen? Das gab es kaum. Schumacher zog notgedrungen Kart-Pneus aus der Abfalltonne, von denen er wusste, dass sie noch für ein paar Runden taugten. So entwickelte er seine Fähigkeit, das Limit zu erkennen, an die Grenze gehen zu können, alles herauszuholen aus sich und der Technik. Effektivität ist der Schlüssel zum Erfolg.
Vincent Gaillardo, einst Motoreningenieur bei Renault, schwärmte von seinem Benetton-Piloten Mitte der Neunzigerjahre so: „Michael kann dir sagen, ob das Fahrproblem am Motor liegt oder am Chassis. Wenn wir 15 Minuten miteinander reden, weiß ich, was ich ändern muss. Bei anderen Piloten kann es eine Stunde dauern, und wir drehen uns immer noch im Kreis.“ Da war sie, die nüchterne Begründung für einen kecken Satz: „Ich bin eine billige Sekunde“, hatte Schumacher behauptet, als einmal sein Millionengehalt diskutiert wurde. So viel allein fürs Gasgeben? Dabei entstand die Basis für sein Führungstempo bei der Diskussion mit den Ingenieuren. Weil die Schnelligkeit der richtigen Gedanken den Vorsprung schaffte. Die Rechnung ging auf: Allein die Verbesserung eines fast ausgereiften Motors zur Senkung der Rundenzeit um ein paar Zehntelsekunden kostete damals nach Angaben der Hersteller 50 Millionen Mark.
Skepsis? Das passt wohl nicht zum Selbstbild von der „billigen Sekunde“. Aber das war der größte Trugschluss unter Schumachers Rivalen. Als er noch öffentlich auftrat, sprach er von ständigem Zweckpessimismus als Triebfeder: „Was ich erreicht habe, muss nicht genügen für die nächste Herausforderung.“ Bei der ersten Runde in einem Formel-1-Rennwagen, 1991 in Silverstone dachte Schumacher: „Das ist verdammt schnell, ob ich das hinkriege?“ Schon nach der zweiten wurde er aufgefordert, langsamer zu machen. So verlief seine Lernphase, immer begleitet von der Vorsicht, sich nur ja nicht sicher zu fühlen, allen Dingen mit unerbittlicher Konsequenz auf den Grund zu gehen. Diese mentale Stärke brachte lange niemand auf. Wenn seine Teamkollegen wie Rubens Barrichello (zu Ferrari-Zeiten) glaubten, auf einem Niveau zu sein mit dem Rheinländer, dann antwortete er mit einer Siegesserie. Es gab Piloten, die über eine Runde schneller sein konnten. Die Finnen Mika Häkkinen und Kimi Räikkönen etwa. Aber niemand hatte diese Konstanz, die Kraft, über Jahre in der Knochenmühle ständig Spitzenleistungen abrufen zu können.
Zwischen 1991 und 2007 fuhr Schumacher zwölf Mal um den Titel. Er „lieferte“, wie die Ingenieure sagen, und besetzte Jahr für Jahr die Rolle des Chefpiloten. Jeweils zu Saisonbeginn hatten Schumachers Teamkollegen für drei, vier Rennen die Chance, den Frontmann anzugreifen. Bei Benetton und Ferrari scheiterten alle. Auch an der Stimmung. Wer die Ferrari-Mannschaft mit Schumacher drei Tage vor einem Rennen Fußball spielen sah, erkannte die Verbundenheit dieses Ensembles: Alle für einen, einer für alle. Erst im Mercedes-Team, als Schumacher nach drei Jahren Pause 2010 wieder einstieg, gelang es Nico Rosberg, sich durchzusetzen gegen den Champion der Champions. Es gab keine Testfahrten mehr, die Schumacher zur akribischen Vorbereitung nutzten konnte, die harten Reifen reduzierten das Tempo und damit den Spielraum für die Könner der Extraklasse. Und Schumacher war 41 Jahre alt.
Dieses Comeback wertete die Rennszene als Niederlage. Kein Sieg, ein dritter Rang, eine Bestzeit im Qualifikationstraining von Monaco in drei Jahren: Da schien nicht mehr der Siegertyp der vergangenen zwei Jahrzehnte im Cockpit zu sitzen. Die Beobachter aber feierten die Entdeckung des herzlichen Schumachers, der gelassener sei, nicht mehr so verbissen ehrgeizig. Er freute sich, aber er sah keine grundlegende Änderung: „Es gibt jetzt andere Regeln, danach richte ich mich.“
Welche Regeln aber herrschten früher? Schumacher wurde zu einer Zeit im Motorsport sozialisiert, in der sich die ganz Großen, Alain Prost und Ayrton Senna, gegenseitig von der Piste schossen, absichtlich. Sie wurden mehr oder weniger bestraft, aber nicht abgestempelt oder geächtet. Senna rückte nach seinem Tod auf der Piste 1994 in den Stand eines Motorsport-Heiligen. Dieser geniale Pilot hatte Schumacher 1992 bei Testfahrten in Hockenheim von der Platzhirschtheorie überzeugt: Er bremste den jungen Deutschen ohne Not aus. Der Brasilianer zeigte dem Talent, wie man gefährliche Konkurrenten einzunorden gedenkt. Auf Schumachers teils rücksichtslose Manöver, auf den Rammstoß gegen Jacques Villeneuves Williams beim Finale 1997 in Jerez oder nach der Park-Affäre beim Qualifikationstraining in Monaco 2006, reagierten selbst ehemalige Kollegen nicht nur mit großer Empörung. Sie stellten gleich alles in Frage, die Siege, die Weltmeisterschaften, die Person. Das lag auch an der anfangs fehlenden Einsicht Schumachers, zu den vergleichsweise harten, aber gemessen an 307 gefahrenen Grand Prix seltenen Fouls öffentlich stehen zu wollen. Schwächen einzuräumen, ist ihm in der Öffentlichkeit sehr schwer gefallen. Woran das lag? Darüber hatte er bis zu seiner schweren Kopfverletzung (in der Öffentlichkeit) nie geredet. Über die Schmähungen, die der Jugendliche aus der Kiesgrube bei Kerpen in der lokalen Motorsportszene ertragen musste. Damals ist ihm offenbar ein Schutzpanzer gewachsen. Es dauerte, bis er vertraute. Aber dann bewies Schumacher Loyalität. Sie reichte weit über Grenzen hinaus, die man gemeinhin toleriert. Nein, die Freundschaft oder Verbundenheit hört doch nicht beim Gelde auf.
Schumacher der Weltstar aus der Kiesgrube: Davon waren auch die Chinesen überzeugt, als sie die Autobahn von Schanghai hinaus zur Rennstrecke mit seinem Konterfei schmückten. Nur er selbst nicht. Fast schüchtern antwortete Schumacher noch als mehrmaliger Weltmeister auf Fragen in großen Fernsehshows, wo er blass aussah neben Zeitgenossen, die parlierten und charmant repräsentierten. Das lag ihm nicht, das konnte er nicht, das wollte er nicht. Seine Bühne war die Piste, wo er alles zeigte, auch große Emotionen: Das Bodycheckmanöver gegen Villeneuve demonstrierte den enormen Druck, der auf ihm lastete als Frontfigur von Ferrari; ebenso der Zorn nach dem von David Coulthard verursachten, lebensgefährlichen Auffahrunfall 1998 in Spa oder die Tränen während der Pressekonferenz in Monza 2000, als ihm nach einem wichtigen Sieg über den Rivalen Häkkinen berichtet wurde, er habe Sennas Sieges-Rekord eingestellt. Der Meister der Beherrschung konnte die Kontrolle verlieren. Denn Schumacher war mit viel mehr Gefühl unterwegs, als er zu erkennen gab. Sonst wäre er über seinen Status hinausgewachsen, zum Volkshelden geworden. Danach sah es anfangs aus. Als er kam und siegte, saugten die Motorsportsfans in Deutschland Schumacher auf wie ein knochentrockener Schwamm das Wasser. In Vorgärten wurden sonntags um 14 Uhr zum Start der Rennen Ferrari-Flaggen gehisst. Die Nationalhymne erklang auf fünf Kontinenten. Kartcenter schossen wie Pilze aus dem Boden, Jungs hängten sich Poster vom König der Autofahrer in ihr Schlafzimmer. Er hat die Menschen inspiriert. Einer ist ihm ganz nahe gekommen, schon als Knirps in Kerpen: Sein Nachfolger Sebastian Vettel.
Trotz seines Umzugs nach Monaco und dann in die Schweiz verdienten viele Menschen an Schumachers Erfolg: Seine Teambesitzer, die Streckenpromotoren, die Rennstallbesitzer, die TV-Anstalten, die Fähnchen- und Kappenverkäufer, ja, auch der Staat. Die Formel 1 war plötzlich in. Man kam, um sich mit Schumacher zu zeigen. Vom Kanzler bis zum Kartenabreißer. Nach den Rennen knieten Fans auf der Startstelle seines Boliden und kratzten Reifengummi vom Asphalt – eine Reliquie für den Schrein daheim. Er hat das nie verstanden, nicht mal die Autogrammjäger, zumindest die erwachsenen. Schumacher wollte ein erfolgreicher Formel-1-Rennfahrer sein, nicht mehr. Kein Beckenbauer des Sports und schon gar nicht wie Boris Becker überall aufschlagen. Er wollte das Leben genießen. „Ich fühle mich wunderbar“, sagte er im Oktober 2012, fast ein Jahr nach seinem Karriereende: „Ich vermisse nichts.“
Ähnlich wie Steffi Graf gelang ihm leicht der Rückzug ins Private. Weil er von seltenen Ausnahmen abgesehen immer ein privater Mensch geblieben war. Wer den Mann treffen wollte, der zwei Jahrzehnte auf allen Pisten dieses Globus abgeschirmt wie ein Staatsmann seine Runden drehte, der hätte nur auf gut Glück losfahren sollen, nach Kerpen, in die ehemalige Kiesgrube. Schumacher liebte es, dort zu sein, wo alles begann, mittendrin, als einer von vielen. So sah er sich auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere: „Ich kann doch nur ein bisschen besser Autofahren als andere.“
Anno Hecker, Juni 2017
Literatur zu Michael Schumacher:
Karin Sturm: Michael Schumacher - Die Biografie. München 2014








