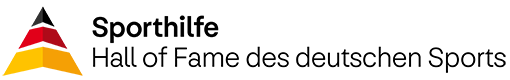
Rudolf Caracciola
Motorsport

- Name Rudolf Caracciola
- Sportart Motorsport
- Geboren am 30. Januar 1901 in Remagen
- Todestag 28. September 1959 in Kassel
- Aufnahme Hall of Fame 2008
- Rubrik 1933–1945
Rudolf Caracciola
Motorsport
Größte Erfolge
- Dreimal Europameister (1935, 1937, 1938)
- Zweimal Berg-Europameister (1930, 1931)
- 15-facher Grand-Prix-Sieger
- Geschwindigkeitsrekord mit 432,7 km/h (1938)
Auszeichnungen
- Denkmal im Geburtsort Remagen
- Aufnahme in die International Motorsports
Hall of Fame (1998) - Seine Pokalsammlung ist in Indianapolis/USA ausgestellt
- Goldenes Band der Sportpresse (1931)
Biografie - Lässige Noblesse
Bevor der erste deutsche Automobil-Held geboren wurde, erlitt er einen Fehlstart. Rudolf Caracciola blieb stehen, als am 11. Juli 1926 auf der Berliner Avus der erste „Große Preis von Deutschland“ angeschossen wurde. Er hatte den Motor seines Mercedes, Typ M218, abgewürgt. Sein Mechaniker musste ihn anschieben, als das 38 Mann starke Fahrerfeld längst auf der Strecke war. Bis der schneeweiße Rennwagen mit der Nummer 14, die auf einer knallroten Bauchbinde lackiert war, wieder lief und Caracciola das Rennen aufnehmen konnte, dauerte es über eine halbe Minute.
Die Kulisse: atemberaubend. 230.000 Menschen drängten sich an die Strecke, die 1921 gebaut worden war und aus zwei zehn Kilometer langen Geraden und zwei engen Kurven bestand. Es regnete in Strömen, aber das scherte die Fans nicht. Sie wurden nun Zeugen einer mythischen Verfolgungsjagd. Caracciola überholte und überholte und setzte, nachdem er in der Box eine schadhafte Zündkerze auswechseln musste, der Konkurrenz erneut entschlossen nach.
Am Ende der knapp 400 Kilometer Renndistanz fuhr Caracciola tatsächlich als Sieger über den Zielstrich – was der 25-Jährige aber nur vermuten konnte, weil das Publikum ihm zujubelte. Eine Kommunikation wie im heutigen Rennsport existierte noch nicht. Profitiert hatte er auch von Unfällen auf der eigentlich viel zu engen Strecke, auf der zwei Menschen zu Tode kamen. Da der Mercedes-Pilot in den letzten Runden mit 200 km/h durch den Regen gerast war, mehrte diese Tragik noch das Pathos. „Es gehört ein todesverachtender Schneid dazu, um bei einem derart unmodernen Bahnrennen mit so großen Geschwindigkeiten auszufahren“, urteilte die Zeitschrift Das Auto.
Mit seinem Sieg jedenfalls katapultierte sich dieser Rudolf Caracciola, der am 30. Januar 1901 als Sohn eines Hoteliers in Remagen am Rhein geboren worden war, auf die große Bühne des internationalen Automobilrennsports. Bis ein gewisser Michael Schumacher kam, war er, der nur „Caratsch“ gerufen wurde, der erfolgreichste deutsche Rennfahrer der Geschichte und verdiente ein Vermögen. 15 Mal gewann Caracciola einen Großen Preis, dreimal wurde er in dieser Renn-Serie Europameister (1935, 1936, 1938). Zudem war er 1931 der erste Ausländer, der die Mille Miglia gewann. Er triumphierte dreimal bei den populären Berg-Europameisterschaften (1930, 1931, 1932). Und 1927 siegte er bei der Eröffnung des Nürburgrings.
Caracciola hatte das Glück, seine Karriere in einer Ära zu starten, die heute als „Roaring Twenties“ bezeichnet werden. Der Rennsport, Symbol des technischen Aufbruchs, boomte in den 1920er Jahren. Schnell musste es sein und laut und neu. Dazu passte der Achtzylinder von Mercedes, den Caracciola zumeist fuhr und so beschrieb: „Eine geballte Synästhesie aus brüllendem Lärm, rasendem Tempo, gleißendem Metall und stechendem Geruch, der an verbrannte Mandeln erinnert und vom Rizinusöl im Treibstoff herrührt.“
Der junge Mann, der eine höhere Knabenschule in Oberkassel und dann eine Lehre als Maschinenschlosser absolviert hatte, ergriff jede Chance. „Ich wollte Rennfahrer werden, von meinem 14. Lebensjahr an“, berichtete er später in seiner Autobiografie, aber das sei ihm aussichtslos erschienen, obwohl er mit 15 Jahren bereits den Führerschein erwarb. „Denn in den bürgerlichen Kreisen, in denen ich aufwuchs, galt Rennfahren als eine Passion spleeniger reicher Leute oder als eine besondere Art von Artistik, etwa wie Seiltanzen.“
Seine ersten Erfolge feierte er noch auf dem Motorrad, während er als Verkäufer der Aachener Fafnir-Werke sein Geld verdiente. 1922 gewann er auf zwei Rädern das Rennen „Rund um Köln“ und belegte beim Avus-Rennen den vierten Rang. Seinen ersten Sieg bei einem Autorennen verzeichnete er 1923 mit einem geliehenen Ego-Kleinwagen – ebenfalls auf der Avus. Es war eine Zeit, in der sich die Fahrer allein mit Brille und Schal gegen den Fahrtwind wappneten. Jedes Rennen bedeutete Lebensgefahr.
„Einzig die Rennfahrer unter sich können beurteilen, welches unendlich starken Willens es bedarf, um trotz zerschlagenen Brillen, trotz schmerzenden Blasen an den Händen, trotz brennenden Füßen, trotz blutig gescheuerten Rippen ein Rennen zu Ende zu fahren“, schrieb Caracciola, der sich trotz aller Kühnheit den Ruf eines schlauen Taktikers und kühlen Strategen erwarb. Qualitäten, die ihm insbesondere in Regenrennen zugutekamen.
Caracciola war, urteilten die Fachjournalisten, zwar einer der wortkargsten Männer der Sportgeschichte. Wenn er dennoch zu einer der berühmtesten Figuren der Goldenen Zwanziger aufstieg, hatte das auch mit dem Bedürfnis der Deutschen nach neuen Helden zu tun – und mit der lässigen Noblesse des Rennfahrers. Obwohl überall gefeiert, sei Caracciola nicht zum strahlenden Idol pervertiert, meint die Sporthistorikerin Swantje Scharenberg, „sondern seine Persönlichkeit entsprach der eines Sportmannes im alten englischen Sinn. Fairness, Introvertiertheit und ein kontinuierliches Arbeiten an seinen Fähigkeiten sowie Glaubwürdigkeit machten sein Verhalten aus.“
Freilich erlebte Caracciola auch Tage, an denen er in Ungnade fiel. Obwohl 1931 noch mit dem Goldenen Band der Sportpresse ausgezeichnet, wurde er 1932 beim Großen Preis von Deutschland vom Publikum ausgebuht – nur weil er, da Mercedes in der Weltwirtschaftskrise ihn nicht mehr als Werksfahrer bezahlen wollte, beim italienischen Fabrikat Alfa Romeo angeheuert hatte. In diesem Rennwagen verunfallte er 1933 beim Großen Preis von Monaco schwer und musste, während er sich davon erholte, noch den Lawinentod seiner Frau verkraften.
Im Jahr 1934 aber startete „Caratsch“ wieder auf Mercedes. Beide, Fahrer und Werk, profitierten nun von den enormen Subventionen der Nationalsozialisten, ebenso wie die Konkurrenten Manfred von Brauchitsch, Hans Stuck, Hermann Lang oder der verwegene Bernd Rosemeyer, der für die Auto-Union fuhr, den großen Gegenspieler der legendären „Silberpfeile“. Der deutsche Automobilrennsport bot in diesen Jahren, so sieht es der Historiker Eberhard Reuß, eine „ideale Bühne für die Nazis, um deutsche Überlegenheit spektakulär in Szene zu setzen“.
Kulminationspunkt dieser Jagd nach Rekorden war das Duell zwischen Caracciola und Rosemeyer in futuristisch anmutenden Karossen, die auf den neuen deutschen Autobahnen Geschwindigkeiten von über 400 km/h erzielten – und mit dem Unfalltod Rosemeyers im Januar 1938 endete. Heute stellt sich die Frage, wer mehr voneinander profitierte: Die Piloten als „Avantgarde des NS-Sports“ (Reuß) oder die NS-Machthaber.
Unzweifelhaft diente Caracciola dem System, wenn er vor der Reichstagswahl 1938 dazu aufrief, dem Führer zu folgen, den er seit 1931 persönlich kannte. „Der Führer hat unseren Fabriken wieder die Möglichkeit gegeben, Rennwagen zu bauen“, schrieb Caracciola im Völkischen Beobachter. Als Caracciola nach seinem Sieg im Großen Preis von Deutschland 1937 mit von Brauchitsch nach Bayreuth für einen Empfang Hitlers im Haus Wahnfried eingeflogen wurde, bedeutete ihm das „den schönsten Lohn für die beiden Sieger im Großen Preis von Deutschland.“
Auf der anderen Seite war Caracciola vor 1933 noch mit dem Schriftsteller und Pazifisten Erich Maria Remarque befreundet und trat nicht in die Partei ein. Seit 1933 aber war er Aushängeschild des Nationalsozialistischen Kraftfahrer-Korps (NSKK). Dessen Führer Adolf Hühnlein beförderte ihn nach Triumphen öffentlichkeitswirksam. Ob der Rennfahrer es bis zum NSKK-Obersturmführer brachte, wie die Motor-Rundschau 1948 wusste, ist nicht belegt. In den Zeitungen wurde er ab 1939 lediglich als NSKK-Staffelführer bezeichnet. „Wenn der Sieg der Waffen errungen ist, wird der Führer auch wieder den Befehl zum Kampf der Rennwagen geben“, schrieb Caracciola 1943 in seinen Erinnerungen.
Seine Rolle als Gladiator in diesem „Römischen Zirkus im Zeichen des Hakenkreuzes“, wie eine Schweizer Zeitung den NS-Rennsport 1935 titulierte, sorgte nach dem Zweiten Weltkrieg für Komplikationen. Denn Caracciola, der seit 1929 in einer mondänen Villa in Lugano residierte, wollte sich in der Schweiz einbürgern lassen (das gelang 1950). Kritische Historiker wie Reuß stufen Caracciola, der am 28. September 1959 in Kassel an einem Leberleiden starb, dennoch nicht als überzeugten Nationalsozialisten ein. Vielmehr sieht er in den meisten Rennfahrern der NS-Ära typische Opportunisten und Ich-AGs: „Sie alle fahren für ihr Vaterland, die Zeiten sind patriotisch, aber in erster Linie fahren sie doch für sich selbst.“
Erik Eggers, Dezember 2024
Quellen und Literatur Rudolf Caracciola:
Rudolf Caracciola: Meine Welt. Wiesbaden 1958
Rudolf Caracciola: Mein Leben als Rennfahrer. Berlin 1939
Uwe Day: Mythos ex machina. Medienkonstrukt „Silberpfeil“ als massenkulturelle Ikone der NS-Modernisierung, (diss.) Bremen 2004
Frank O. Hrachowy: Stählerne Romantik, Automobilrennfahrer und nationalsozialistische Moderne. Norderstedt 2008
o. Verf.: Caracciola über seinen Besuch beim Führer, In: Nationalzeitung, 2. August 1937
Günther Molter: Rudolf „Caratsch“ Caracciola. Außergewöhnlicher Rennfahrer und eiskalter Taktiker. Stuttgart 2009
Eberhard Reuß: Hitlers Rennschlachten. Die Silberpfeile unterm Hakenkreuz, Berlin 2006
Swantje Scharenberg: Die Konstruktion des öffentlichen Sports und seiner Helden in der Tagespresse der Weimarer Republik. Paderborn 2012







